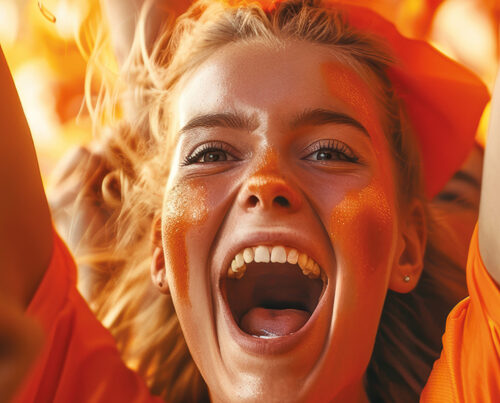Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in „neue verpackung“ im September 2024.
Die Ansprüche an Verpackungen haben sich stark gewandelt. Konzentrierte sich die Entwicklung von Verpackungen früher vor allem auf Aspekte wie Funktionalität und Werbewirksamkeit, so ist in den letzten Jahren das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus gerückt. Verpackungen sollen nun auch möglichst recyclingfähig sein – denn je leichter sie sich wiederverwerten lassen, desto wertvoller sind sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Doch wann ist eine Verpackung recyclingfähig?
Antwort darauf geben in Deutschland die Stiftung „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ (ZSVR) und das Bundesumweltamt mit ihrem „Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen“, der jährlich aktualisiert wird. Demnach gilt eine Verpackung als recyclingfähig, wenn für sie eine Recyclinginfrastruktur vorhanden ist, wenn die Verpackung außerdem eindeutig sortierbar ist, gegebenenfalls die Verpackungskomponenten trennbar sind und es keine Recycling-Unverträglichkeiten gibt.
Vorgaben für Recyclingfähigkeit werden strenger
Wer heute in Deutschland Verpackungen auf den Markt bringt, sollte unbedingt den Grad ihrer Recyclingfähigkeit kennen – und bei Bedarf optimieren. Denn nicht nur die Bundesregierung, auch die EU hat ambitionierte Ziele zur Förderung der Nachhaltigkeit von Verpackungen. So haben sich das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten im Frühjahr auf neue Regeln für nachhaltige Verpackungen geeinigt. Demnach sollen ab 2030 strenge Vorgaben für die Recyclingfähigkeit jeder Verpackung gelten, die anschließend schrittweise verschärft werden. Doch auch heute schon haben bei den meisten großen Handelsunternehmen in Deutschland nur noch solche Produkte eine Chance, in die Regale zu kommen, deren Verpackung einen bestimmten Grad an Recyclingfähigkeit nach ZSVR-Mindeststandard erfüllen.
Verpackungen aktuell nur zu 65 Prozent recyclingfähig
Dr. Wolf Karras ist Werkstoffwissenschaftler und Experte für Ökodesign bei EKO-PUNKT, dem Dualen System von REMONDIS. Im Verpackungslabor des Unternehmens prüft der Spezialist regelmäßig Verpackungen auf ihre Recyclingfähigkeit – und zeigt auf Wunsch Optimierungspotenziale auf. „Viele Unternehmen sind das Thema bereits angegangen und haben in Sachen Wiederverwertbarkeit in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erzielt. Aber insgesamt gibt es noch viel Luft nach oben“, berichtet Karras. Nach Einschätzung des Experten sind Verpackungen von Lebensmitteln und Drogeriewaren derzeit über das Gesamtsortiment betrachtet zu etwa 65 Prozent recyclingfähig. „Wenn alle Unternehmen ihre Verpackungen entsprechend dem heutigen Stand der Technik optimieren würden“, so Karras, „könnte man im Schnitt sicherlich auf bis zu 85 Prozent Recyclingfähigkeit kommen, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen.“
Das richtige Material auswählen
Optimales Recycling beginnt für den Ökodesign-Experten schon bei der Materialauswahl. Eingesetzt werden sollten nur solche Materialien, für die es als Verpackung eine existierende Sortier- und Recyclinginfrastruktur gibt. Das sind bei nahezu allen Kunststoffverpackungen derzeit vor allem die Polymere Polypropylen (PP) und Polyethylen (HDPE und LDPE) sowie, beschränkt auf die Flaschenform, Polyethylenterephthalat (PET). Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch und lassen sich anschließend sehr gut in hochwertige Rezyklate umwandeln.

Dr. Wolf Karras, Werkstoffwissenschaftler und Experte für Ökodesign bei EKO-PUNKT
Ideal ist es zudem, wenn die gesamte Kunststoffverpackung aus einer einzigen Polymerart besteht. Sollte der Einsatz eines Monokunststoffs aus Gründen der Funktionalität nicht möglich sein, sollte wenigstens die Zahl der eingesetzten Polymerarten so weit wie möglich minimiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Polymere sich in Kerneigenschaften unterscheiden, weil sie sich dann bei der maschinellen Aufbereitung in der Recyclinganlage – zum Beispiel durch eine Dichtetrennung im Wasser oder durch Ausblasen mit Luftdüsen – einfacher separieren lassen. Außerdem sollten die Komponenten so verarbeitet sein, dass sie in der Anlage leicht voneinander getrennt werden können, beispielsweise durch Zerkleinern.
„Wenn alle Unternehmen ihre Verpackungen entsprechend dem heutigen Stand der Technik optimieren würden, könnte man im Schnitt sicherlich auf bis zu 85 Prozent Recyclingfähigkeit kommen, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen.“
Dr. Wolf Karras, Werkstoffwissenschaftler und Experte für Ökodesign bei EKO-PUNKT
Kombinationen von nicht-kompatiblen Materialarten vermeiden
Ein Verbund von Kunststoffarten, die nicht miteinander kompatibel sind, sollten Hersteller im Sinne der Nachhaltigkeit vermeiden. „Bei Verpackungen von Wurst- oder Käseaufschnitt“, weiß Karras zu berichten, „besteht die Schale häufig aus PET und die aufgesiegelte Folie aus PE. Da man PET jedoch nicht siegeln kann, wird auf das PET noch eine dünne PE-Schicht aufgetragen, so dass man im Endeffekt PE mit PE verbinden kann.“ Das Problem: PET und PE sind nun fest miteinander verbunden – man kann daraus später also weder reines PET noch PE zurückgewinnen. Eine solche Verpackung gilt nach Mindeststandard als nicht recyclingfähig. Eine einfache Lösung, um eine solche Verpackung besser wiederverwertbar zu machen wäre es laut Karras, die Schale aus PP zu fertigen. Dieser Werkstoff kann zusammen mit PE hochwertig verwertet werden. Zusätzliche Schutzbarrieren für das verpackte Gut, zum Beispiel aus EVOH, stören das Recycling ebenfalls nicht.
Verzichten sollten Verpackungsentwickler auch auf die Kombination von Kunststoff mit anderen Materialarten, die die Sortierung behindern oder gar unmöglich machen. Zumindest dann, wenn sich die unterschiedlichen Verpackungskomponenten beim Entsorgen oder in der Sortieranlage nicht leicht voneinander trennen lassen. Auch hierfür hat Karras ein Beispiel: „Wenn eine Verpackung auf der einen Seite aus Kunststoff und auf der anderen Seite aus Papier besteht, wird sie – je nachdem, mit welcher Seite nach oben sie auf dem Sortierband liegt – vom Nahinfrarot-Scanner entweder als Kunststoff oder als Papier erkannt. Das heißt: Etwa die Hälfte dieser Verpackungen wird nicht richtig zugeordnet und geht somit für das Recycling verloren.“ Aufgabe des Nahinfrarot-Scanners ist es, das Material der Verpackung zu erkennen und sie automatisch der richtigen Materialfraktion zuzuordnen. Auch großflächige Papieretiketten auf einer Kunststoffverpackung können die optische Sortierung beeinträchtigen. Durch die Umstellung auf ein kleineres Kunststoffetikett lässt sich die sensorgestützte Materialerkennung unterstützen und das Recycling verbessern.
Papierverbundverpackungen:
„Der Schuss geht nach hinten los!“
Den Trend zu Papierverbundverpackungen, bei denen Pappe mit Kunststoff beschichtet wird, um ihr Eigenschaften des Kunststoffs wie seine Wasserfestigkeit zu verleihen, sieht Karras besonders kritisch: „Mit der Umstellung von einer reinen Kunststoffverpackung auf einen Papierverbund wollen die Hersteller den Kunststoff in der Verpackung reduzieren – doch der Schuss geht nach hinten los! Denn anders als bei einer reinen Kunststoffverpackung lässt sich der bei einem Verbundstoff eingesetzte Kunststoff nicht und der Papieranteil bestenfalls nur anteilig recyceln.“ Eine Verpackung aus einem Monokunststoff wie PP oder PE, die vollständig wiederverwertet werden kann, ist aus Sicht von Karras die ökologisch sinnvollere Alternative.
Problematisch ist auch die Kombination von Kunststoff und Metall, denn letzteres ist in der Sortierung dominant. Besitzt beispielsweise eine Verpackungsrolle für Chips einen Boden aus Weißblech, wird die Verpackung in den Dosenschrott sortiert und unter vollständigem Verlust der Restverpackung als Eisen verwertet, auch wenn dieses nur 15 % des Verpackungsgewichtes ausmacht. Vergleichbar ist es mit Kaffeebeuteln aus Kunststoff und Aluminiumfolie, die dann als Aluminium verwertet werden.
Farbe: Je heller, desto besser
Eine weitere Stellschraube, an der Hersteller drehen können, um ihre Kunststoffverpackungen nachhaltiger zu gestalten, ist die Farbe. Denn aus einem dunkel eingefärbten Kunststoff kann auch nur ein dunkles Rezyklat hergestellt werden. Die Weiterverwertung in neuen Verpackungen ist dadurch deutlich eingeschränkt. Wenn möglich, empfiehlt Karras daher die Verwendung von transparenten oder hellen Materialfarben. Verzichten sollten Verpackungsentwickler in jedem Fall auf schwarze, rußbasierte Kunststoffe. Denn in der Sortieranlage absorbieren sie das Signal des Nahinfrarot-Scanners, sodass dieser die Materialart nicht erkennt. Die Verpackung wird in der Folge nicht in eine hochwertige Materialfraktion aussortiert und bleibt vom weiteren Recyclingprozess ausgeschlossen.
Störstoffe ersetzen
Auch Etiketten können mit ihren Bestandteilen wie Farben, Lacken oder Klebern das Recycling negativ beeinflussen. Denn sie können das Rezyklat verunreinigen und somit seine Qualität mindern oder das Recycling gleich komplett verhindern. „Hitzeunbeständige Komponenten sollten Hersteller daher vermeiden“, rät Karras, „weil sich diese beim Umschmelzen zersetzen und den Kunststoff unbrauchbar machen.“ Stattdessen empfiehlt er den Einsatz von wasserlöslichen Klebern, weil so das ganze Etikett mit allen Störstoffen vollständig im Recyclingprozess zu entfernen ist. Wer das Recycling optimal unterstützen möchte, ersetzt das Etikett gleich ganz durch eine transparente, abtrennbare Banderole aus einem anderen Werkstoff als den der Verpackung.
„Oft braucht es nicht viel“, fasst Karras zusammen, „um die Recyclingfähigkeit einer Verpackung zu optimieren. Bereits mit kleinen Veränderungen lassen sich meist schon deutliche Verbesserungen erzielen, ohne dass die Kernfunktion der Verpackung – nämlich den Schutz des Produkts – dabei beeinträchtigt wird.“
Bildnachweise: © REMONDIS